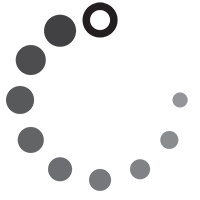|
Des Teufels Steg: Seite 156
Das Einzige, was er mit Sicherheit wusste, überlegte Richard, während er nach der fehlgeschlagenen Kontaktaufnahme am Geländer der Brücke stand, seine Pfeife rauchte und auf das fließende Wasser der Bode starrte, war die Tatsache, dass Elke bei der Seilbahn arbeitete. Die Chancen, sie dort anzutreffen, lagen gar nicht so schlecht, glaubte Knöpfle, denn gestern war er seiner »neuen Liebe« im Bahnhof am Nachmittag begegnet, was vermutlich kein Zufall gewesen war, sondern die Konsequenz dessen, dass die Frau diese Woche Spätschicht hatte. Sie musste auf der Arbeit sein und reagierte aus diesem einfachen Grund nicht auf seine Anrufe, ging dem Schriftsteller endlich ein Licht auf. Kurzerhand beschloss er, ins Auto zu steigen und auf gut Glück zur Seilbahn nach Thale zu fahren. Er wollte mit der Frau unverzüglich und um jeden Preis reden! Die Straße nach Thale, die zuvor schon Gerlinde auf ihrer Flucht entlanggewandert war, schlängelte sich leicht über die Harzer Hochebene dem Rande des Plateaus entgegen und war absolut leer, als der Schriftsteller wenig später mit heulendem Motor und quietschenden Reifen ihren noch stellenweise feuchten Belag strapazierte. Richard gab richtig Gas, ohne Rücksicht auf Verkehrsschilder und Geschwindigkeitsbegrenzungen, trotz der unübersehbaren Gefahr, in einer Kurve von der Straße abzukommen und im Graben zu landen. Er rätselte über den wahren Grund für seinen plötzlichen Sinneswandel, die innere Triebfeder, die ihn verrückte Dinge tun ließ, welche er sich noch vor einer Stunde nicht hätte vorstellen können. Knöpfle war sich nämlich nicht mehr sicher, ob der seelische Antrieb nur auf seinem egoistischen Wunsch fußte, Elke zu verführen, oder auch edle, ehrsame Beweggründe mit im Spiel waren wie derjenige, so schnell wie möglich Verbündete für sein Anerkennung verdienendes Vorhaben, die Bekämpfung des rechtradikalen Ungeziefers auf der Waldlichtung, zu finden. Und es gab ja da noch den verschwundenen Breitscheid, der sich in genau der Stadt, die Richard gerade besuchen wollte, wie in Luft aufgelöst hatte. Ob der Weinhändler auch eine Rolle dabei spielte und ob er, Richard, sich unterschwellig Hoffnungen machte, auf irgendwelche Spuren von dem verschollenen Vertreter zu stoßen? Das fragte sich der Märchenschreiber und ahnte nicht, wie nahe er schon zu der Aufklärung des Rätsels mit dem Handelsreisenden in jenem Augenblick befand, als er an dem Abzweig zur Roßtrappe vorbeiraste, aber den Schriftsteller traf keine Schuld – Richard verfügte schlicht und einfach nicht über hellseherische Fähigkeiten.
Wolfgang Breitscheid wachte unterdessen allmählig auf – es wäre wahrscheinlich treffender formuliert gewesen, wenn man angesichts seines Zustandes über das zögerliche Wiedererlangen des Bewusstseins gesprochen hätte – und fand sich auf dem Boden liegend entweder in einem unterirdischen Kellergewölbe oder einer Art Hütte wieder, die keine Fenster besaß und nur sehr spärlich beleuchtet war. Er konnte eine Weile nichts Genaueres von seiner Umgebung erkennen, denn nach dem Schlag auf den Kopf sah er alles doppelt und dreifach. Nur ein hellerer Fleck in der Mauer, die ihn von allen Seiten umgab, fiel ihm deutlich ins Auge und der Handelsreisende hielt ihn für die Eingangsöffnung. Als der Schwindel ein wenig nachgelassen hatte, kroch er mühevoll bis zur Wand, die sich einen ausgestreckten Arm weit von ihm entfernt befand, richtete schwerfällig seinen Oberkörper auf und lehnte mit dem Rücken an den aufeinandergeschichteten großen, scharfkantigen Steinen, aus denen das Mauerwerk bestand. Übers Aufstehen verschwendete der entkräftete Weinhändler nicht mal einen Gedanken, er wäre auf der Stelle umgefallen, nahm Breitscheid nicht grundlos an, denn allein schon das Sitzen fiel ihm überaus schwer.
(?)
Wolfgangs Schädel brummte gewaltig und wenn er sich mit den Fingern durch das Haar fuhr, spürte er unter seiner Handfläche eine dicke, hässliche Beule am Hinterkopf, die höllische Schmerzen verursachte und eine durchaus mit seinem leicht deformierten Gesicht harmonierende Ergänzung zu seiner äußeren Erscheinung bildete. Zum Glück konnte er nirgendwo vertrocknete Blutreste entdecken. Der Weinhändler erinnerte sich stückchenweise an die Einzelheiten seiner Auseinandersetzung mit dem urmenschlich anmutenden Typen, der ihn anscheinend k. o. geschlagen hatte, aber die Erinnerungen beantworteten in keiner Weise die Frage, wo er sich aktuell befand und was ihn in absehbarer Zukunft erwartete. Von draußen, durch die Öffnung in der Wand, die mit einem Vorhang versehen war, drangen Laute menschlicher Unterhaltung an sein Ohr, aber auch hier wurde Wolfgang den Eindruck nicht los, dass er die Stimmen zwiefach hörte. Doch zuweilen glaubte er, es waren zwei verschiedene Gespräche, die er im Wechsel oder, besser gesagt, nur geringfügig zeitlich zueinander versetzt vernahm, sodass man sie für ein und dieselbe Diskussion mit mehreren Teilnehmern halten konnte, die aber dennoch nicht das Mindeste miteinander zu tun hatten. Bald waren es ein Kind, das in einem für Wolfgang verständlichen Deutsch sprach und offenbar seine Mutter fragte: »Was ist das für ein Turm, Mutti? Gehen wir da rein, bis nach ganz oben?«, und eine Frau, die ablehnend antwortete: »Nein, Schatz, du siehst ja, die Tür ist verschlossen!«, und bald hörte er zwei aufgeregte männliche Stimmen, die nach seiner laienhaften Beurteilung genau dieselbe Sprechweise verwendeten, wie er sie von dem Kerl mit der Schlagkeule an der Brücke gehört hatte. Er konnte die meisten Wörter ihrer Sprache im Redefluss nicht recht gut auseinanderhalten, aber zwei Ausdrücke fielen besonders oft: schœn magedîn und lam wīp. Je länger der Handelsreisende an der Wand saß und gezwungenermaßen dem Klang der Stimmen lauschte, desto mehr kam er zu der Überzeugung, dass die Frau mit dem Kind einerseits und die steinzeitlichen Männer andererseits mitnichten einander verstehen, geschweige denn ausgedehnte Gespräche miteinander führen konnten – nicht nur aufgrund sprachlicher Unterschiede, sondern vielmehr, weil die vermeintlichen Gesprächsparteien augenscheinlich nicht die geringste Ahnung von ihrer gegenseitigen Existenz hatten. Die Frau kommunizierte nur mit dem Kind und die Männer führten ihren eigenen Dialog. Ein leiser Verdacht entstand in Wolfgangs Kopf wie ein formloser, diffuser Schatten, der umso deutlichere Konturen erhielt, je schärfer Breitscheid seine Umgebung nach und nach sehen konnte. Mit großem Unbehagen stellte er wenig später fest, dass jedes Mal, wenn er die Frauenstimme hörte, sich auch der Raum um ihn herum auf eine seltsame Weise veränderte: Es wurde etwas heller, offenbar durch die vergitterte Fensteröffnung, deren Umrisse Wolfgang an der gegenüberliegenden Mauer wahrnahm, und die niedrige Decke schien sich spurlos zu verflüchtigen, denn die gemauerten Wände verloren sich weit oben, dort, wohin die Treppe führte, die sich ihm plötzlich schemenhaft präsentierte. Doch sobald die vertraut klingenden Laute aus dem Munde der Frau verstummten, fand er sich erneut in der dunklen Kammer mit nach Erde und Schimmel riechender Luft wieder und hörte die Unterhaltung der merkwürdigen menschlichen Wesen jenseits des Türvorhangs.
|
Diese Seite weiterempfehlen»Link an Freunde senden
KurzinhaltWolfgang Breitscheid, ein Handelsreisender in Sachen Wein aus Hannover, findet sich plötzlich in der Zeit des Spätmittelalters wieder, während er eine ungeplante Verkaufsreise in den Harz unternimmt. Sein neuer Bekannter, ein Schriftsteller namens Richard Knöpfle, besitzt diese Fähigkeit nicht, aber während er nach dem unerwartet verschwundenen Weinvertreter sucht, stößt er auf eine Zusammenkunft von Rechtsradikalen aus Jena, die im Harz ein Hexenfeuerfest feiern. Derweil sich Richard mit der arischen Vereinigung auseinandersetzt, macht Wolfgang Bekanntschaft mit der Heiligen Inquisition. Es kommt zu einer entscheidenden Schlacht zwischen Gut & Böse und das Edle gewinnt – vorerst, denn das Übel ist nur schwer zu besiegen.Über den Autor
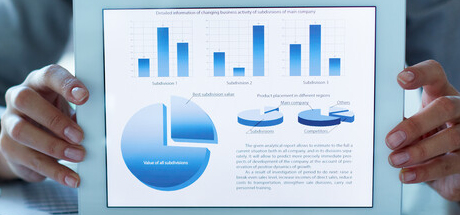
Zahlen & Daten zum Werk
 Ihre Spende ist willkommen!Wir stellen Ihnen gerne alle Inhalte unserer Webseite kostenlos zur Verfügung. Sie können die Werke auch in der E-Book-Version jederzeit herunterladen und auf Ihren Geräten speichern. Gefallen Ihnen die Beiträge? Sie können sie alle auch weiterhin ohne Einschränkungen lesen, aber wir hätten auch nicht das Geringste dagegen, wenn Sie sich bei den Autoren und Autorinnen mit einer kleinen Zuwendung bedanken möchten. Rufen Sie ein Werk des Autors auf, an den Sie die Zuwendung senden wollen, damit Ihre Großzügigkeit ihm zugutekommt.Tragen Sie einfach den gewünschten Betrag ein und drücken Sie auf "jetzt spenden". Sie werden anschließend auf die Seite von PayPal weitergeleitet, wo Sie das Geld an uns senden können. Vielen herzlichen Dank! Diese Seite weiterempfehlen»Link an Freunde senden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leseecke © 2026